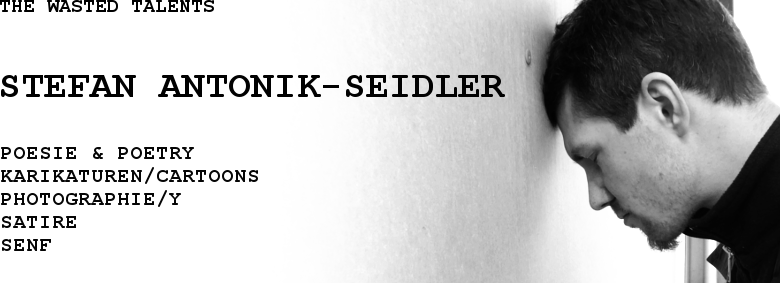Es gibt kein Oben, ohne ein Unten. Aber ist die Erde, dieser Planet unseres Lebens, nicht groß, stark, über uns, kleine Wesen, die sich auf ihrer Oberfläche tummeln, ganz erhaben, wiewohl sie zu unseren Füßen liegt? Und ist der Himmel, zu dem die einen betend empor blicken, mit Erfurcht manche, andere aber mit Wissbegierde forschend, nichts anderes, als eine Schutzhülle vor der unendlichen Kälte des Weltraums, in dessen Wettern sowohl Nutzen, als auch Zerstörung wirkt? Wer würde also meinen, das Oben des Himmels zum Beherrscher unseres Lebens zu machen und das Erdreich ganz zu knechten? Bebt die Erde, brechen Dämme, schwemmt ihr Wasser unsere Häuser in die Abgründe; blüht sie, grünt sie, mit allem Gewürm und Krabbelgetier, auf das manch einer verächtlich tritt, so haben die Menschen sattes Leben – wer will dieses Schaffen nun unterdrücken?
Die Menschen wollen es, seit Gezeiten und je besser sie es können, umso heftiger wollen sie es; und wie sie die Erde zu versklaven wünschen, so machen sie’s mit ihresgleichen. Selbstredend bleibt die Erde sich selbst und frei; die versklavten und unterdrückten Menschen aber, ächzen umso mehr. Über ihnen sitzen die menschlichen Falschherrscher, in ihren hohen Türmen, über allem ganz fern; betrachten sich selbst stets, als das Obere, auch wenn sie im Dreck ihrer Macht kriechen. Der Himmel aber, der wahrlich über allem liegt, besteht vielfach aus Gewölk, das sich aufbaut, mit gewaltiger Majestät, ehe es heulend nieder bricht und all die Becken füllt, die Flüsse und die Felder speist.
Der falsche König bleibt auf seinem Throne sitzen und kommt niemals herab, um sein Werk zu verrichten. Wer aber nicht niedersteigt, kann auch nicht aufsteigen, zur Majestät des Himmels. Und wer die Majestät des Himmels erkennt, muss die Majestät der Erde sehen, die am Horizont ihre Krone zeichnet. In ihr sammelt sich alles Wasser, ehe es erneut emporsteigt, sie ist der Urgrund unseres Reisens, der Schoß unserer Existenz. Mit dem Erdreich vergleichen jene Oberen die Volksmassen, die sie düngen und vergiften, bis alles erstickt und verdirbt, um sie abzuernten oder im Mist verwesen zu lassen. Sie sehen das Erdreich nicht, deshalb sehen sie das Volk nicht, und wie auch, sind sie doch blind, sich selbst gegenüber.
Wollen sie wie der Himmel sein, müssen sie vom Wetter lernen: Sein Wirken kommt mit seinem steten Wandel. Wer so ein Werk verrichtet, soll dabei nicht verweilen, nur dann tränkt mensch das Erdvolk dauerhaft, mit dem, wonach ihm dürstet. Wollen sie die Völker aber knechten, wie die Erde, so sollten sie erkennen, dass sie den Berg auf die Spitze zu stellen wünschen. Die Erde ist da, wo sie ist, lebenschaffend – wohin will man sie verrücken? Will man Gruben sprengen, um den Reichtum zu füllen, bis kein Grund mehr über ist, für den Palast? Ein Beben von ihr, ein Erdrutsch und die Reichsten sind dahin – und nachdem ihre Körper zu ihr zurückgekehrt, ganz aufgelöst sind in ihr, füllen sich die Gruben mit Wasser und in den Ruinen der Paläste nistet neues Leben, ganz ohne Herrschaft.
Der Himmel unterdrückt die Erde nicht. Sie hält ihn an sich, damit er nicht in den Weltraum entschwindet, so beatmet und beschirmt er ihr Leben. Der Himmel dient der Erde, bleibt zugleich in seinem Wesen frei und wild. Und so muss der obere Mensch, der sich über allen anderen wähnt, erkennen, dass er nicht nützt, wenn er nicht dem dient, was ihn oben hält. Er halte sich rein, befreie sich von Giften, dann können die Völker rein und frei von Giften werden.
Es gilt auch für die Erdvölker: Was sie an Giften nehmen, womit sie sich verunreinigen, steigt auf, um über ihnen Wolken zu werden. Und das Gewittern der Oberen sollen sie nicht fürchten, es zieht vorüber und würde es nicht vorüberziehen, würde es hernieder fallen und das Erdreich tränken. Wer sich fürchtet, wird beherrscht. Erkennt man aber den Dienst des Oberen, so kann man sich dienen lassen – sowie man sich zu halten lassen weiß, wenn man den Halt erkennt, dem einen das Untere verleiht.
Wer sich das Erdreich untertan machen will, muss herabsteigen und ihm dienen; wer sich am Erdvolk vergreift und dabei verweilt, der kann es nicht herrschen. Wer Schutz und Segen des Oberen wünscht, der muss es halten, wo es dient, wo aber nicht, es verwehen lassen, von den Stürmen, die ihm selbst zu Eigen seien. Und man speise die Bereiche des anderen, womit man gespeist sein will. Der Ursprung der Zweiheit – von Oben und Unten, Himmel und Erde, Oberen und Unteren im Erdvolk – ist die Einheit. Tao.
Donnerstag, 28. Oktober 2010
Wieder im Garten alter Möbel
Im Garten alter Möbel, im hellen Zwielicht,
Hausschluchtenschein am Ende,
Campinglicht auf meine Hände,
Dämmernd auf Möbel: lichtes Gewicht;
Macht weich die Sicht,
Auf das, was war und ruht,
Im Innern, schlecht und gut,
Was wühlt und sticht.
Dazu besänftigend, die zarten Klänge,
Saiten, hoch und tief, getrommelt leise,
Und hohl, und klingend, auf matte Weise,
Drückend federleicht, gegen die Enge.
So wird’s Herz nun schwerer,
Wie Geist und Seel sich hebt,
Und es leise in mir bebt,
Sich füllt, und wird doch leerer.
Will man erleichtern so das eine,
Drückt anderes bald mehr;
Strömt man seine Seele leer,
Nachfüllt sie sich bald von alleine.
Melancholisch wurde das genannt,
Das ruhige, starke Spiel,
Vertraut daher und gleichviel,
Mir, ist es jung und alt bekannt;
Und doch so von der Fremde singend,
Die ich blind mir malen kann,
An einen Markstein, im Irgendwann,
Mit Hoffnung, Wunsch und Wissen ringend.
Die Klänge passen mir hierher,
In meine schmale Kammer nicht –
Den weißen Turm, in allem Licht;
Zwielicht, da sinniert’s mir sehr.
Ja, selbst im künstlichen Nachtschatten,
Gedeihen wohl die besten Träume;
Wenn ich auch harre, manches versäume,
Es wächst stets neu, was wir einst hatten.
Irgendwo, in Zeit und Raum,
Einzigform hat jedes Blatt,
Das, für sich, Schönheit hat –
In Fülle, am einzelnen Baum;
Und wie im Wald,
Und dann nicht mehr,
Und dann wieder,
Wie bald.
Vom Wald weit weg,
Von der Kammer, weit,
Von der Weißenturmzeit,
Auf zwielichtem Weg.
Wo Logik nicht mehr sieht,
Tastet Seele sich voran;
Und wenn sie nur noch irren kann,
Hilft Verstand, dass es geschieht.
Harren in alter Möbel Garten,
Versäumen, erwachsen erneut,
Drum auf dem Weg noch heut,
Zu allen andren Einzigarten.
Hausschluchtenschein am Ende,
Campinglicht auf meine Hände,
Dämmernd auf Möbel: lichtes Gewicht;
Macht weich die Sicht,
Auf das, was war und ruht,
Im Innern, schlecht und gut,
Was wühlt und sticht.
Dazu besänftigend, die zarten Klänge,
Saiten, hoch und tief, getrommelt leise,
Und hohl, und klingend, auf matte Weise,
Drückend federleicht, gegen die Enge.
So wird’s Herz nun schwerer,
Wie Geist und Seel sich hebt,
Und es leise in mir bebt,
Sich füllt, und wird doch leerer.
Will man erleichtern so das eine,
Drückt anderes bald mehr;
Strömt man seine Seele leer,
Nachfüllt sie sich bald von alleine.
Melancholisch wurde das genannt,
Das ruhige, starke Spiel,
Vertraut daher und gleichviel,
Mir, ist es jung und alt bekannt;
Und doch so von der Fremde singend,
Die ich blind mir malen kann,
An einen Markstein, im Irgendwann,
Mit Hoffnung, Wunsch und Wissen ringend.
Die Klänge passen mir hierher,
In meine schmale Kammer nicht –
Den weißen Turm, in allem Licht;
Zwielicht, da sinniert’s mir sehr.
Ja, selbst im künstlichen Nachtschatten,
Gedeihen wohl die besten Träume;
Wenn ich auch harre, manches versäume,
Es wächst stets neu, was wir einst hatten.
Irgendwo, in Zeit und Raum,
Einzigform hat jedes Blatt,
Das, für sich, Schönheit hat –
In Fülle, am einzelnen Baum;
Und wie im Wald,
Und dann nicht mehr,
Und dann wieder,
Wie bald.
Vom Wald weit weg,
Von der Kammer, weit,
Von der Weißenturmzeit,
Auf zwielichtem Weg.
Wo Logik nicht mehr sieht,
Tastet Seele sich voran;
Und wenn sie nur noch irren kann,
Hilft Verstand, dass es geschieht.
Harren in alter Möbel Garten,
Versäumen, erwachsen erneut,
Drum auf dem Weg noch heut,
Zu allen andren Einzigarten.
Dienstag, 26. Oktober 2010
Blühender Garten alter Möbel
Ein Garten alter Möbel im Campinglicht,
Fallende Gedanken, wie’s Herbstlaub da draußen:
Computerplastik, Staubgeruch,
PC-Speaker, Ventilatorentönen,
Blauer Sonnenschein und Gewölk,
Dämmerung und Dunkelheit,
Sterne, Mushrooms, Blumen,
Und pixelgeformte Gestalten.
Im Garten alter Möbel, im Campinglicht,
Gedanken fallen, wie’s Herbstlaub da draußen;
So fallen sie dem Kopf jetzt ins Gewicht,
Von damals, dergestalt von Außen.
Und dergestalt im Innern, wie tiefer Wald,
Das Banale und die Melancholie,
Mit manch schlauem Scherzen bald,
Abenteuerlust, Geschichte, Fantasie.
Hinterm kühlen Glas, warm flimmert die Zeit,
Vorüber, am Kokon des Schreibtischs, driftend;
Und vorbei an allen Augen, weit und breit,
Dann in kosmischer Einsamkeit, sich nistend.
Das Kerlchen mit dem Schwert und Schild,
Das es nicht gibt und niemals gab,
Nur hier – und Bilder wirbeln wild,
Es fällt von seinem Ursprung ab.
Langeweile,
Heldentum,
Zeit verbringen,
Nur wohin?
Ich wollte es nie und tat es doch,
Wollt es stets und immer wieder,
Tat’s aber nicht, versuche noch,
Wenn’s wächst, fällt es bald nieder.
Allein – unterm Himmel, überm Feld;
Im Garten alter Möbel, da im Zwielicht,
Viele Sondermenschen, dieser sexy Welt,
Weich spielt zarte Musik, zur klaren Sicht.
Was immer war, wird niemals sein.
Sein wird, was ich war, das ist,
Soll lebendig sein, teil mein,
An dem Unmögliches sich misst.
Voller Zeiten,
Voller Weltenweiten,
Derer Viele,
All dieser Spiele.
Und mehr.
Fallende Gedanken, wie’s Herbstlaub da draußen:
Computerplastik, Staubgeruch,
PC-Speaker, Ventilatorentönen,
Blauer Sonnenschein und Gewölk,
Dämmerung und Dunkelheit,
Sterne, Mushrooms, Blumen,
Und pixelgeformte Gestalten.
Im Garten alter Möbel, im Campinglicht,
Gedanken fallen, wie’s Herbstlaub da draußen;
So fallen sie dem Kopf jetzt ins Gewicht,
Von damals, dergestalt von Außen.
Und dergestalt im Innern, wie tiefer Wald,
Das Banale und die Melancholie,
Mit manch schlauem Scherzen bald,
Abenteuerlust, Geschichte, Fantasie.
Hinterm kühlen Glas, warm flimmert die Zeit,
Vorüber, am Kokon des Schreibtischs, driftend;
Und vorbei an allen Augen, weit und breit,
Dann in kosmischer Einsamkeit, sich nistend.
Das Kerlchen mit dem Schwert und Schild,
Das es nicht gibt und niemals gab,
Nur hier – und Bilder wirbeln wild,
Es fällt von seinem Ursprung ab.
Langeweile,
Heldentum,
Zeit verbringen,
Nur wohin?
Ich wollte es nie und tat es doch,
Wollt es stets und immer wieder,
Tat’s aber nicht, versuche noch,
Wenn’s wächst, fällt es bald nieder.
Allein – unterm Himmel, überm Feld;
Im Garten alter Möbel, da im Zwielicht,
Viele Sondermenschen, dieser sexy Welt,
Weich spielt zarte Musik, zur klaren Sicht.
Was immer war, wird niemals sein.
Sein wird, was ich war, das ist,
Soll lebendig sein, teil mein,
An dem Unmögliches sich misst.
Voller Zeiten,
Voller Weltenweiten,
Derer Viele,
All dieser Spiele.
Und mehr.
Donnerstag, 21. Oktober 2010
Halleluja Tao
Alte Musik macht mich jung,
Die Angst führt mich zum Mut.
Frei vom Alk, kommt der Rausch,
Durchs Tanzen, da finde ich Ruhe.
Halleluja!
Tao
Die Angst führt mich zum Mut.
Frei vom Alk, kommt der Rausch,
Durchs Tanzen, da finde ich Ruhe.
Halleluja!
Tao
Montag, 11. Oktober 2010
Gekiest und zugefallen
Herbstfarben und Feuerkaskaden, auf Baumkronen und Hecken,
Aufblühend im Verblühen, im Feiern des kreisenden Todes.
Es leeren und füllen sich meine Kreise, treten aus ihren Verstecken,
Die Formen alter Gestalten, die ich einst wahr, im Zug meines Loses.
Gekiest ist der Weg, hier und da, und knirschend, bevor er sich erneuert;
Und doch scheint er mir, im Zufall erhoben, zur Bestimmung zu streben,
Im Kreisen, mit alten Zungen zu sprechen, was ich hatte beteuert,
Und was ich bereute, im unsagbaren G’fühl, klingt nach Sinn, im Leben.
Tod und Leben, und vieles mehr, fällt herab in allen Farben,
Von uralten Gewüchsen, in vielfältigen Gärten, nur wage zu vereinen,
Die vielfach Geborenen, im Protz, im Laben oder zu Trotzen, im Darben,
Wenn die Wege kreiseln, dann wird alles, wie ein Herbstbild, erscheinen -
Gekiest und zugefallen.
Aufblühend im Verblühen, im Feiern des kreisenden Todes.
Es leeren und füllen sich meine Kreise, treten aus ihren Verstecken,
Die Formen alter Gestalten, die ich einst wahr, im Zug meines Loses.
Gekiest ist der Weg, hier und da, und knirschend, bevor er sich erneuert;
Und doch scheint er mir, im Zufall erhoben, zur Bestimmung zu streben,
Im Kreisen, mit alten Zungen zu sprechen, was ich hatte beteuert,
Und was ich bereute, im unsagbaren G’fühl, klingt nach Sinn, im Leben.
Tod und Leben, und vieles mehr, fällt herab in allen Farben,
Von uralten Gewüchsen, in vielfältigen Gärten, nur wage zu vereinen,
Die vielfach Geborenen, im Protz, im Laben oder zu Trotzen, im Darben,
Wenn die Wege kreiseln, dann wird alles, wie ein Herbstbild, erscheinen -
Gekiest und zugefallen.
Dienstag, 5. Oktober 2010
Dagewesener
Das Gift in der Lunge,
Im Kopf und Schmerzen,
Bis hinauf zur Zunge,
Spukend mein letztes Scherzen.
Ich ziehe mich zurück, wie immer, wenn ich getroffen bin;
Und hadernd drohe ich, dem dämmernden Sinn.
Hinter dem Gebirge, verrät der Wind, liegt er,
Groß und irrig und wahr, bald gut, bald bös, bald mehr.
In meinen Jahren war ich Geist,
Sprach und schrieb ich in ihm,
Durch ihn,
Was Seele preist und zerreist.
In der Welt war ich Muskeln,
Schaffte und trug, bis hin zur Liebe.
War im Wort einmal Wankeln,
Hielten Zähne sie, damit sie bliebe.
Doch war im Körper ein Schwächeln,
Schlugen als Antwort, stumme Tränenhiebe.
Den Menschen war ich Muskeln, war ich Körper, in meinen Jahren.
Doch nicht mir und irgendwann, vielleicht bald, nimmermehr,
Da kann man weinen, kann man klagen und kann’s doch nicht bewahren,
Was die Menschen wollen, schwindet und was ich will, geb’ ich her.
Was die Menschen wollen, schwindet,
Wie es sie auch bindet,
Ans Unbändige,
Und was ich aushändige,
Wird dann sein, was ich wirklich war und bin,
Wenn die Hände das Zeichnen lassen,
Nicht mehr können (werden die Menschen - die es nicht schon tun - mich gern haben können), alles Fleisch dahin,
Ich werde (Dagewesener) Etwas sein und alles andere verblassen.
Im Kopf und Schmerzen,
Bis hinauf zur Zunge,
Spukend mein letztes Scherzen.
Ich ziehe mich zurück, wie immer, wenn ich getroffen bin;
Und hadernd drohe ich, dem dämmernden Sinn.
Hinter dem Gebirge, verrät der Wind, liegt er,
Groß und irrig und wahr, bald gut, bald bös, bald mehr.
In meinen Jahren war ich Geist,
Sprach und schrieb ich in ihm,
Durch ihn,
Was Seele preist und zerreist.
In der Welt war ich Muskeln,
Schaffte und trug, bis hin zur Liebe.
War im Wort einmal Wankeln,
Hielten Zähne sie, damit sie bliebe.
Doch war im Körper ein Schwächeln,
Schlugen als Antwort, stumme Tränenhiebe.
Den Menschen war ich Muskeln, war ich Körper, in meinen Jahren.
Doch nicht mir und irgendwann, vielleicht bald, nimmermehr,
Da kann man weinen, kann man klagen und kann’s doch nicht bewahren,
Was die Menschen wollen, schwindet und was ich will, geb’ ich her.
Was die Menschen wollen, schwindet,
Wie es sie auch bindet,
Ans Unbändige,
Und was ich aushändige,
Wird dann sein, was ich wirklich war und bin,
Wenn die Hände das Zeichnen lassen,
Nicht mehr können (werden die Menschen - die es nicht schon tun - mich gern haben können), alles Fleisch dahin,
Ich werde (Dagewesener) Etwas sein und alles andere verblassen.
Abonnieren
Posts (Atom)