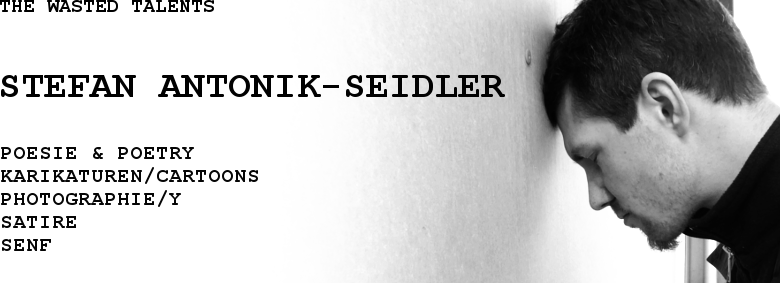Schön ist das Eichenblatt – überall;
Wie all die Düfte voller Reife,
Kurz vorm Wintertod,
Alles dann stirbt,
Vermeintlich.
Ich hock im Schwarzen – am Licht,
Das mir Fluchtschatten spendet,
Wo’s mir nun bange wird,
Nimmer Zuflucht,
Scheinfeindlich.
Sind’s die aufgesognen Ängste,
Die im weichen Schatten,
Liegen, wohl sich wiegen,
In meinen Schlaf,
Vielleicht Sinnlos.
Ist’s der Ort, er selbst,
Die Materie im Sinn,
Des Richtigen,
Des Falschen,
Vielleicht Gewinnlos.
Aber Handeln muss ich,
Weil ich will – und mehr,
Da bin ich plötzlich,
Weites Stapfen führt hierher.
Montag, 27. September 2010
Dienstag, 21. September 2010
Der Sommer fällt schon von den Bäumen
Manch Baum bräunt sich schon im Hauch,
Des kühlen Windes kündender Wende,
In herbstreifer Sonne, dort sitz ich auch;
Zwielicht fällt in meine Hände.
Um mich wirbelt egozentrisch Blechverkehr,
Auf den Staub – Ihr Nasen,
Riecht euch auch der welkende Verzehr,
Der Welt, im Brennen und Gasen.
Kein Innehalten an ihren losen Botschaften,
Wenn Wehmut jäh mich schlägt,
Mich erinnernd, an innig weite Landschaften,
Eines Waldes, fern und herbstbelegt.
Ich bleib noch wandernd im Hochhaustal,
Denn anywhere is nowhere Guys,
Und anytime is no time, für den Fall,
Dass ich im Dasein leben weiß.
Winter wird bald alles kalt verschlingen;
Sitz dann in tiefer Dunkelheit,
Wo Geister und Geschichten mit mir ringen,
Selbst gebärend, der neuen Zeit.
Ein Kondensstreifen durchglüht das Blühen,
Des milchigen Himmelblaus, ganz hell;
Und bald werden wir Winters Wehen fühlen,
Kondensierend, frierend, schneeblau, grell.
Ich muss durchforsten das baldige Wintern,
Dann durch den geweißten Wald;
Doch in der Stadt, der Waldesnähe fern,
Ist’s eine Bar, ich suche bald.
I died once and will this time too;
Kampfschrei des Gebärens hörst du,
Kraft wächst in schmerzlich tönender Ruh,
Dann strebst du dem Wandel zu.
Und der stete Wandel strebt zu dir,
Das Vergehen ist deine Quelle.
Harrst du auch all der Mauern hier,
Wandelst doch bald an ihrer Stelle.
Angst ist Angst, wenn sie ist,
Ein lautes Nichts im All;
Winter, den du vielleicht vermisst,
In des Sommers stillen Fall.
Des kühlen Windes kündender Wende,
In herbstreifer Sonne, dort sitz ich auch;
Zwielicht fällt in meine Hände.
Um mich wirbelt egozentrisch Blechverkehr,
Auf den Staub – Ihr Nasen,
Riecht euch auch der welkende Verzehr,
Der Welt, im Brennen und Gasen.
Kein Innehalten an ihren losen Botschaften,
Wenn Wehmut jäh mich schlägt,
Mich erinnernd, an innig weite Landschaften,
Eines Waldes, fern und herbstbelegt.
Ich bleib noch wandernd im Hochhaustal,
Denn anywhere is nowhere Guys,
Und anytime is no time, für den Fall,
Dass ich im Dasein leben weiß.
Winter wird bald alles kalt verschlingen;
Sitz dann in tiefer Dunkelheit,
Wo Geister und Geschichten mit mir ringen,
Selbst gebärend, der neuen Zeit.
Ein Kondensstreifen durchglüht das Blühen,
Des milchigen Himmelblaus, ganz hell;
Und bald werden wir Winters Wehen fühlen,
Kondensierend, frierend, schneeblau, grell.
Ich muss durchforsten das baldige Wintern,
Dann durch den geweißten Wald;
Doch in der Stadt, der Waldesnähe fern,
Ist’s eine Bar, ich suche bald.
I died once and will this time too;
Kampfschrei des Gebärens hörst du,
Kraft wächst in schmerzlich tönender Ruh,
Dann strebst du dem Wandel zu.
Und der stete Wandel strebt zu dir,
Das Vergehen ist deine Quelle.
Harrst du auch all der Mauern hier,
Wandelst doch bald an ihrer Stelle.
Angst ist Angst, wenn sie ist,
Ein lautes Nichts im All;
Winter, den du vielleicht vermisst,
In des Sommers stillen Fall.
Montag, 20. September 2010
Lioba Jasna
Ungebunden
Unverwunden
Und Ungestört
Nicht verstört
Ohne Zwang
Und ohne Drang
Liebe ich
Dich
Überm Sehr
Mein Liobär
(S’ reimt auf da,
Sich Lioba.
Da wir sind,
Mit diesem Kind.
Und du schreist,
Ich bell mit dir,
Du greinst,
Und lachst mit mir.
Arrr! ich keif,
I’ am here and alive,
Du sagst Ha!
Ich sing Li-O-Ba)
Unverwunden
Und Ungestört
Nicht verstört
Ohne Zwang
Und ohne Drang
Liebe ich
Dich
Überm Sehr
Mein Liobär
(S’ reimt auf da,
Sich Lioba.
Da wir sind,
Mit diesem Kind.
Und du schreist,
Ich bell mit dir,
Du greinst,
Und lachst mit mir.
Arrr! ich keif,
I’ am here and alive,
Du sagst Ha!
Ich sing Li-O-Ba)
Sprache
Die alten neuen Demagogen kikerikien,
Hinweg über Meinung und Gehirn,
Über renovierte Straßen in Wien.
In neuer Zeit, alter Ängste Wirren.
Ich seh einen Berg, auf dem steht Heston,
Dann, um ihn her, die andren Festredner;
Geladen zu schlachtrufen gen Westen.
Mit jedem Wort, der Berg wird ebener.
Und gegen Osten ziehen her,
Die frömmlerischen Bergnomaden,
Quaken fromm, schlachtrufen sehr.
Furcht und Zorn in den Waden.
Darum allein steht in der Mitte,
Im Nirgendwo und überall,
Ein Berg und Volk gleichsamer Sitte,
Zu leben im Sein, göttlichem Universal
Zu finden, den universalen Sinn,
Das Eine und Verständnis,
Im Andren, ist der Sprache Gewinn;
Und der Sprecherkunst Verhängnis.
Demagogen kunstsprechen mit Gewinn,
Über Sprache selbst, dieser wirren Tage.
Aber sie bedeuten keinen Sinn,
Schöner Klang allein, ist ihre Gabe.
Und aller Sprachen guter Nutzen,
Wird ehrloser Politik geschlachtet,
Um zu blenden und zu verdutzen,
Bis keiner mehr den Nutzen achtet.
Der Berg der Mitte aber kündet,
Sprache allein ist mein Erlangen,
Wo es lautet, wo es mündet,
Wenn wir nach einander verlangen.
Also verlange ich nach deinem Sinn,
Bruder, Schwester, dieser wirren Tage,
Denn alles Gute ist mein Gewinn,
Wenn ich auch deine Sprache trage.
Hinweg über Meinung und Gehirn,
Über renovierte Straßen in Wien.
In neuer Zeit, alter Ängste Wirren.
Ich seh einen Berg, auf dem steht Heston,
Dann, um ihn her, die andren Festredner;
Geladen zu schlachtrufen gen Westen.
Mit jedem Wort, der Berg wird ebener.
Und gegen Osten ziehen her,
Die frömmlerischen Bergnomaden,
Quaken fromm, schlachtrufen sehr.
Furcht und Zorn in den Waden.
Darum allein steht in der Mitte,
Im Nirgendwo und überall,
Ein Berg und Volk gleichsamer Sitte,
Zu leben im Sein, göttlichem Universal
Zu finden, den universalen Sinn,
Das Eine und Verständnis,
Im Andren, ist der Sprache Gewinn;
Und der Sprecherkunst Verhängnis.
Demagogen kunstsprechen mit Gewinn,
Über Sprache selbst, dieser wirren Tage.
Aber sie bedeuten keinen Sinn,
Schöner Klang allein, ist ihre Gabe.
Und aller Sprachen guter Nutzen,
Wird ehrloser Politik geschlachtet,
Um zu blenden und zu verdutzen,
Bis keiner mehr den Nutzen achtet.
Der Berg der Mitte aber kündet,
Sprache allein ist mein Erlangen,
Wo es lautet, wo es mündet,
Wenn wir nach einander verlangen.
Also verlange ich nach deinem Sinn,
Bruder, Schwester, dieser wirren Tage,
Denn alles Gute ist mein Gewinn,
Wenn ich auch deine Sprache trage.
Sonntag, 12. September 2010
Leaving The Dubh Linn
Alles gut dann,
Wie man Abgerundetheit,
Kalt und nächtlich schmecken kann,
Im malzig-schwärzlichen Pintglas.
Über die dunkle Anna Liffey hin,
Keuchte ihr mein stetes Schreiten;
Mit letztem Zweifel im dunklen Sinn,
Um das Meer noch zu erreichen.
Und gut dann,
Verirrte ich mich doch.
Die Hafenanlagen gafften stille,
Und die Shamrocks schliefen noch,
Gefaltet, als ich eines pflückte.
Lies trübe mich dann leiten,
Wohin mein Aug mich drückte,
Um ins große Schwarz zu gleiten.
Alles gut also,
Es war das Meer,
Mit dessen stillen, fremden Schwemmen,
Drang vertrauter Wind einher.
Ins Buch legte ich das Kleeblatt,
Schrieb mit Wasser, löschte mit Sand,
Und alle Geister waren satt,
Für eine Weile, am schwindenden Strand.
Gut, gut, gut,
Wenn ich ins kühle Strömen falle,
Warmer Menschen dieses Stadions,
Und zwischen ihnen leise wandle,
Wie ein Geist, so schattig unerkannt.
Ins Pub mit ihnen, nicht mit mir,
Ehe Closingtime an meiner Hand,
Streng mir kiest, das letzte Bier.
Der Flieger in der Morgenröte,
In frühsten Stunden müde dann,
Dröhnt über Banjo, Fidel und Blechflöte,
Die ich unirisch wieder hören kann –
Alles gut dann.
Wie man Abgerundetheit,
Kalt und nächtlich schmecken kann,
Im malzig-schwärzlichen Pintglas.
Über die dunkle Anna Liffey hin,
Keuchte ihr mein stetes Schreiten;
Mit letztem Zweifel im dunklen Sinn,
Um das Meer noch zu erreichen.
Und gut dann,
Verirrte ich mich doch.
Die Hafenanlagen gafften stille,
Und die Shamrocks schliefen noch,
Gefaltet, als ich eines pflückte.
Lies trübe mich dann leiten,
Wohin mein Aug mich drückte,
Um ins große Schwarz zu gleiten.
Alles gut also,
Es war das Meer,
Mit dessen stillen, fremden Schwemmen,
Drang vertrauter Wind einher.
Ins Buch legte ich das Kleeblatt,
Schrieb mit Wasser, löschte mit Sand,
Und alle Geister waren satt,
Für eine Weile, am schwindenden Strand.
Gut, gut, gut,
Wenn ich ins kühle Strömen falle,
Warmer Menschen dieses Stadions,
Und zwischen ihnen leise wandle,
Wie ein Geist, so schattig unerkannt.
Ins Pub mit ihnen, nicht mit mir,
Ehe Closingtime an meiner Hand,
Streng mir kiest, das letzte Bier.
Der Flieger in der Morgenröte,
In frühsten Stunden müde dann,
Dröhnt über Banjo, Fidel und Blechflöte,
Die ich unirisch wieder hören kann –
Alles gut dann.
Abonnieren
Posts (Atom)